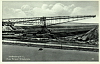Mit den überaus detailreichen Ausführungen meines Administrators zur
ABRAUMFÖRDERBRÜCKE
und ihren technischen Daten kann ich natürlich nicht mithalten.
Ich halte es da lieber mit dem kleinen Büchlein >Der Braunkohlentagebau<, das 1988 im Kinderbuchverlag Berlin erschien.
Eine der darin enthaltenen Illustrationen zeigt den riesigen BRÜCKENVERBAND und klärt den interessierten Nachwuchs über die einzelnen Großgeräte und deren Besatzung auf:
"Die
ABRAUMFÖRDERBRÜCKE muß man sich als ein übergroßes
FÖRDERBAND vorstellen. Ein eigenes Grabwerkzeug besitzt sie nicht.
Deshalb ist sie immer mit mindestens einem oder zwei Baggern verbunden.
Dieser gesamte Gerätekomplex wird als
BRÜCKENVERBAND bezeichnet.
Die beiden Bagger sind
EIMERKETTENBAGGER...
Jeder Bagger hat seinen
BAGGERFÜHRER, und auf der Brücke befinden sich 2
BRÜCKENFAHRER, der erste auf der Bagger~,
der andere auf der Kippenseite...
Zur Besatzung eines Verbandes gehören 15 Bergleute.
Das sind neben den Baggerführern und Brückenfahrern noch Maschinisten und Bandwärter... "
Es ist nur schwer vorstellbar, dass eine verschwindend geringe Anzahl von Bergleuten dieses GROSSGERÄT am Laufen halten kann.
Als negativer Beigeschmack rückt dann allerdings der Verlust von eingesparten Arbeitsplätzen ins Blickfeld.
Kein Wunder also, dass bereits kurz vor Inbetriebnahme der
FÖRDERBRÜCKE ILSE-OST im Jahre 1931 die ersten diesbezüglichen Warnungen im >Senftenberger Anzeiger< auftauchten:
"Die
RATIONALISIERUNG hat das Niederlausitzer Industriegebiet vor schwere Probleme gestellt. Sein Lebensnerv ist der
BRAUNKOHLENBERGBAU; und in ihm sind die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in den letzten Jahren von Grund auf verändert worden.
Bei
ILSE-OST wird eben eine
RIESENFÖRDERBRÜCKE aufgestellt, bewundernswerte Konstruktionen, die 50 Meter hohes Erdreich abbaggern,
die Kohlenflöze abbauen und sie im Tagebau fördern, ohne daß bei den vielen hier vereinten Arbeitsgängen Menschenhände sich mühen brauchten.
Wenn die Arbeit getan ist - und wie schnell ist ein Flöz freigelegt und gefördert -,
eilt das Riesenwerk mit allen Gleisen selbsttätig der neuen Arbeitsstätte zu,
ohne daß dafür mehr als die wenigen Automaten regulierenden Arbeitshände erforderlich wären.
Von diesen Maschinen, die im einzelnen Werte bis zu 10 Millionen Mark repräsentieren, ersetzt eine jede die Arbeit von 350 Bergarbeitern.
Der Zeitpunkt wird sicherlich eintreten und er kann nicht mehr ferne sein, wo der derzeitige Stand der
RATIONALISIERUNG die Bearbeitung kleinerer Felder nicht mehr gestattet oder unproduktiv erscheinen läßt.
So hat die
TECHNISIERUNG des Bergbaues nicht nur zeitbedingt viele Arbeiter arbeitslos gemacht; man wird vielmehr mit einer dauernden Arbeitslosigkeit von einigen tausend Bergarbeitern rechnen müssen, die nie wieder in ihrem eigenen Arbeitsgebiet werden wirken können.
Die Frage, wie künftig der Kohlenabbau gestaltet werden soll, ist nicht nur für den Bergbau, sondern auch für die Städte und Gemeinden, die heute von dem Vorhandensein der Kohle profitieren, von großer, ja entscheidender Bedeutung.
In spätestens 50 Jahren und für wichtige Gebiete schon in 10 Jahren und noch früher wird die gesamte Niederlausitz für den Tagebau ausgekohlt sein.Dann bleibt nur noch der Untertagebau oder der Verzicht auf jegliche Förderung."
Nach der Prognose von 1931 wäre also 1981 "Schicht im Schacht" gewesen.
Das eingangs zitierte Kinderbuch hielt mit viel Optimismus dagegen:
"30 Jahre werden wohl noch vergehen, bis die letzte 'Schaufel Kohle' gewonnen ist.
Dann werden ausgedehnte Wiesen, junge Kiefernbestände das Gesicht der Landschaft bestimmen, die über Jahrzehnte dem Bergbau gehörte. Ein See wird an heißen Sommertagen zum Bade einladen, Segelboote und Surfer lautlos über das Wasser,
50 Meter über dem Standort des letzten Kohlebaggers gleiten. Und das ist keine Phantasie..."
Einfache Rechnung: 1988 plus 30 Jahre = 2018.
Die SENFTENBERGER hatten es bekanntlich sehr eilig und weihten schon 1973 "hochgradig vorfristig" und mit großem Enthusiasmus den ersten Strandabschnitt am >Senftenberger See< ein.
An die vielen Bergleute, die nach 1990 ihre Arbeit verloren, erinnert man sich allerdings mit großer Wehmut... .